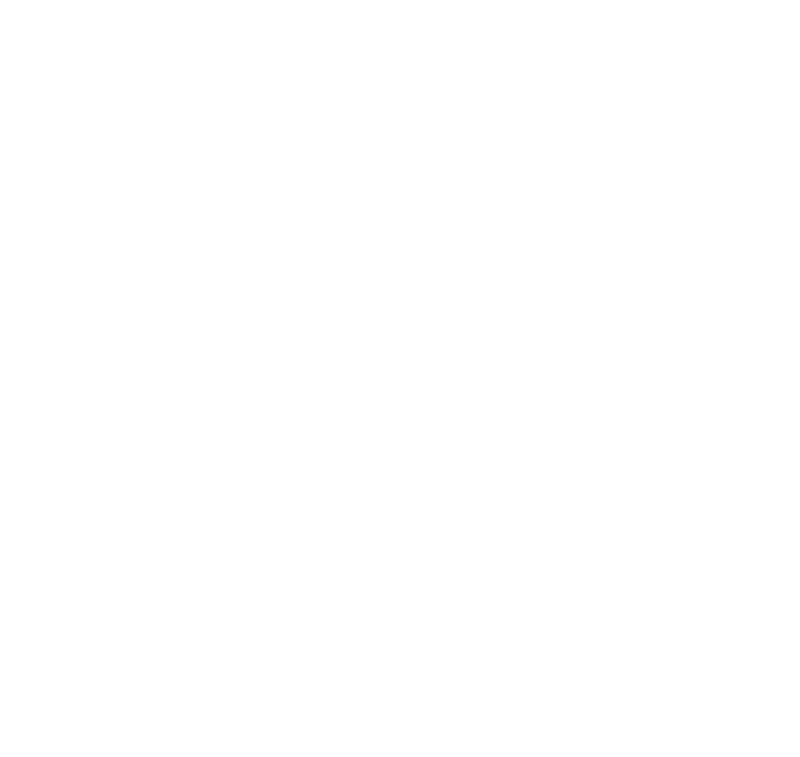Ich stelle folgende These in den Raum: Schüler und Lehrkräfte liefern sich eine Battle of the GPT-Chatbots und beide Seiten geben sich damit zufrieden. Aufgabenstellungen werden mit KI-Chatbots erstellt, Schüler generieren wiederum die Lösungen mit Chatbots, Lehrkräfte kontrollieren diese dann schlussendlich mit Bots. Im stillen Agreement reduziert sich so das Arbeitspensum aller Beteiligten auf ein Minimum. Das ist scheinbar eine typische Win-win-Situation zum Zwecke der Aufwandsvermeidung. Das hört sich falsch und nicht zielführend im Sinne einer nachhaltigen Ausbildung an? Richtig erkannt, denn neben der Zeit- und Energieverschwendung (eine Chatbot-Anfrage kostet im Schnitt 0,3 bis 2,9 Wh) ist dieses Vorgehen auch weit entfernt vom Bildungsauftrag, nachhaltigen Wissenserwerb und einer individuellen Leistungsbeurteilung. Wie kann in Zeiten der digitalen Assistenzsysteme eine sinnvolle Aufgabenerstellung und Leistungsbeurteilung erfolgen?
Die Gegebenheiten haben sich verändert: digitale Assistenten wie Copilot, Grok, Gemini, ChatGPT, uvm. sorgen, vorausgesetzt diese werden zielführend und reflektiert eingesetzt, für eine deutliche Effizienzsteigerung und sind ein vielfältiges Toolkit an Möglichkeiten in der Bildung. Aber so wie Smartphone und Laptop die Potenziale des mobile Computings eröffnen, aber auch schnell zum Ablenkungsfaktor im Unterricht werden können, steht die unproduktive Anwendung von KI im Bildungsbereich dem Lernerfolg mehr im Weg, als diesen zu fördern.
Realityflash für Pädagogen
Lehrkräfte sind mehr denn je gefordert, den Einsatz und die Nutzung zweckdienlich zu lenken, was auch der Dienstpflicht des Lehrers entspricht. Dazu ein kurzer Auszug aus den Dienstpflichten des Lehrers (§ 17, 51 und 63a SchUG, § 29 ff LDG, § 8 LVG, § 10 LVG):
- Hauptaufgabe ist die Unterrichts- und Erziehungsarbeit.
- Sorgfältige Vorbereitung des Unterrichts.
- Aufsichtspflicht über die Schüler.
- Wahrung der Interessen des Schulwesens (Sicherstellung des Lernerfolgs, Berufsvorbereitung, Redlichkeit, Fleiß, Arbeitshaltung …).
- …
Lehrkräfte, die sich damit zufriedengeben, den Technologieeinsatz zum Selbstzweck werden zu lassen und die bloße Anwesenheit von Tablet, Laptop und Smartphone schon als progressive Unterrichtsumgebung zu bezeichnen, sollten ihre Rolle in der Wissensvermittlung hinterfragen.

Aus didaktischer Sicht noch übler wird es, wenn der Lern- und Übungsprozess zur besagten Bot-Battle wird. Dabei üben Schüler dann nur noch Copy-and-Paste und sinnbefreites replizieren. Im Worst-Case-Szenario wird ein Arbeitsauftrag im Unterricht (oder eine Hausübung) nur mehr insofern bearbeitet, als dass dieser in den Chatbot kopiert und „mach mir die hausübung“ gepromptet wird. Das ist aktuell die Realität in vielen Klassenzimmern, oft auch noch durch die Lehrkräfte forciert: „Nehmts die KI, dann brauch ich nicht so viel korrigieren“.
Die Grenze zwischen förderlichem Technologieeinsatz und unfruchtbarer Beschäftigungstherapie sind fließend. Der Arbeitsauftrag kann schnell vom Mittel zum Wissens- und Kompetenzerwerb zum Gegenteil mutieren, zu einer Tätigkeit, die kaum intellektuellen Einsatz fordert und aufgrund der Automatisierbarkeit die Schüler eher ermüdet als fördert. Jetzt könnte das so gern genutzte Whataboutism-Argument kommen: „Leistungswillige und interessierte Schüler setzen sich ja gern und freiwillig mit dem Arbeitsauftrag auseinander und profitieren doch davon“. Falls das stimmen sollte, akzeptiert man aber trotzdem immer noch die Vernachlässigung eines größeren Teils der Klasse, nämlich jene, die sich ohnehin schon mit den Unterrichtsinhalten schwertun.
Was tun?
Es gibt keine Patentlösung: Die Gesellschaft muss mit der technologischen Entwicklung schritthalten und sich adaptieren. Technologie zu verteufeln ist ebenso falsch wie diese zu glorifizieren und als Allheilmittel zu sehen. Die KI-Roboterarmee, die für uns arbeitet und ein Grundeinkommen für jeden erwirtschaftet, wird zu unseren Lebzeiten nicht Realität werden, da augenscheinlich nicht einmal die Sozialisten das Thema Maschinen-/Algorithmensteuer ernsthaft ansprechen möchten.
Es muss erst ein Bewusstsein entstehen, dass Wissens- und Kompetenzerwerb, Leistungswille und Fleiß die eigene Persönlichkeit bereichern und daraus ein persönlicher und gesellschaftlicher Nutzen entsteht – auch wenn dieser aus der Sicht eines Schülers nicht immer gleich erkannt werden kann.
Für jene, die in ihrem Beruf mit Leistungsbeurteilung und Expertisen zu tun haben, kann es hilfreich sein, sich den Zweck von Leistungsbeurteilung vor Augen zu führen: In einer Leistungsgesellschaft erfüllen Noten und Beurteilungen mehrere Funktionen:
- Feedback in Kurzform: Eine Note erlaubt durch ihre Definition ein Kurzfeedback, wo keine ausführliche Leistungsbeschreibung möglich ist.
- Selektion: Auslese für höhere Bildung/Berufe, Einsatzbereiche und Tätigkeiten.
- Prognose und Analyse: Vorhersage zukünftiger Leistungen und Arbeitshaltung.
- Information/Rückmeldung: Für Schüler, Eltern, Arbeitgeber.
- Zurechtweisung: Einfluss auf nicht förderliches Verhalten und Einstellungen.
- Diagnose: Lernstand prüfen, Unterricht planen.
- Motivation und Belohnung: Lernen fördern.
- Sozialisation: Vorbereitung auf zertifikatsbasierte Gesellschaft.
- Lernen lernen: Eigenverantwortliches Lernen fördern.
Davon kann man jetzt ein paar Regeln für die eigene Beurteilungsarbeit ableiten, mit besonderem Hinblick auf die Möglichkeiten der Beurteilungsverzerrung durch digitale Assistenzsystem:
- Nur mehr Leistungen vor Ort (in kontrollierter Umgebung) und mit definierten bzw. ohne Hilfsmittel können mit hoher Gewichtung in die Leistungsbeurteilung einbezogen werden (Mitarbeitsüberprüfungen, Tests, Leistungsfeststellungen …).
- Umfangreiche und komplexe Projektangaben und Arbeitsaufträge, die einen KI-Einsatz nötig machen, um im zeitlichen Rahmen (Hausübung, mehrwöchiges Projekt) lösbar zu sein.
- Nutzung eines Noten-Gewichtungssystems, damit bei der Verrechnung der Teilnoten die Vor-Ort-Leistungen höher als die Zuhause-Leistungen einfließen.
- Protokolle über die Hilfsmittelverwendung einfordern. Darin sollen zB. Prompts, Evaluierung von KI-Systemen, Plausibilitätsprüfungen, Verifizierungen und ein Reflektieren des Hilfsmitteleinsatzes enthalten sein.
- Förderung des Bewusstseins, dass digitale Assistenz sinnvoll und effizienzsteigernd ist, dem eigenen Kompetenzerwerb aber nicht hinderlich sein darf.
- Förderung diverser Aspekte einer Qualitätskontrolle der eigenen Ergebnisse.
- Klare Nutzungsregeln aussprechen und von den Schülern durch Unterschrift bestätigen lassen.
- Ethische Leitlinien, die sich zB. vom europäischen AI-Act ableiten lassen.
- KI-Resistente Aufgaben: Mündliche Präsentationen und Prüfungen, reflexive Fragen, Peer-Review, Falsifizierung, Verifizierung, …
- Abkehr von zu allgemein formulierten Aufgaben: Statt beispielsweise „Schreibe einen Aufsatz zum Klimawandel.“ besser „Analysiere ein lokales Klimadaten-Set mit KI, dann diskutiere in der Gruppe, warum deine Annahmen falsch waren.“ formulieren.
- Auf eine mögliche Anwendung von KIs bei der Bearbeitung eines Arbeitsauftrags mit Beispielen hinweisen bzw. diese sogar einfordern, natürlich mit Protokollierungspflicht.
- Mündliche Gespräche, Entwurfsprozesse darstellen lassen, bewertete Diskussionen und Leistungskontrollen am Unterrichtsende durchführen.
- Förderliche Nutzung von KI aufzeigen, indem auf personalisierte Lernpfade, Recherchemöglichkeiten, usw. hingewiesen und diese demonstriert werden.