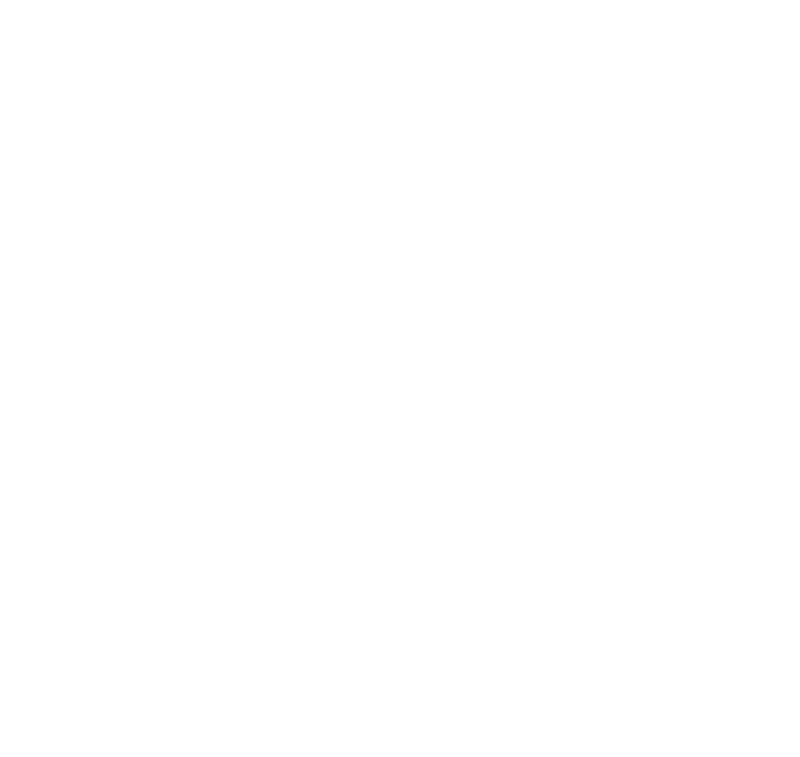Der österreichische Jurist Viktor Mayer-Schönberger prägte vor über einem Jahrzehnt den Begriff des Rechts auf Vergessenwerden. Digitale Informationen sollen mit einer Art Ablaufdatum versehen werden und somit automatisch, nach Ablauf einer definierten Frist, gelöscht werden. Dieser Ansatz wurde 2011 von der Europäischen Kommission aufgegriffen und in einen Vorschlag zur Änderung des Datenschutzgesetzes inkludiert. Bei einer späteren Abstimmung wurde dieser Passus jedoch entfernt und stattdessen zumindest das Recht auf Löschung verankert. Zwischen dem Recht auf Vergessenwerden und dem Recht auf Löschung bestehen jedoch erhebliche Unterschiede in der praktischen Anwendung.
Man könnte das Recht auf Löschung personenbezogener Daten als Minimalkompromiss bezeichnen. Internetplattformen und Lobbyisten haben erfolgreich – bedacht auf die Wahrung der eigenen monetären Interessen – die Umsetzung eines automatisch wirkenden Mechanismus des digitalen Vergessenwerdens torpediert. Anstatt einen maschinellen Automatismus der Löschung zu etablieren, wird der Mechanismus auf Internet-Dienstanbieter und deren Benutzer abgewälzt, ähnlich der in der Praxis fragwürdigen Umsetzung der Cookie-Richtlinie. Denn auch bei der Cookie-Richtlinie wäre ein Automatismus technisch einfach zu implementieren: Eine Browseroption, die der Benutzer nur einmal in den Einstellungen konfigurieren muss, wäre für Website-Betreiber und Benutzer effektiver als die gegenwärtig Lösung, nämlich auf jeder Website eine erforderliche Zustimmung mittels Dialog einzuholen. Eine ähnliche Funktionalität ist in Browsern schon vorhanden und wird als Do-Not-Track bezeichnet. Website-Betreiber sind jedoch rechtlich nicht verpflichtet, diese Option zu berücksichtigen.
Aufgrund fehlender Automatismen entsteht einerseits nun die Situation, dass Personen selbst aktiv werden müssen, um eine Löschung einzufordern. In vielen Fällen kann auch noch ein Rechtsbeistand zur Durchsetzung erforderlich sein. Andererseits müssen Dienstanbieter Ressourcen bereitstellen und die Anfragen prüfen und bearbeiten. Wie lange dieser Prozess dauert und ob dieser dann überhaupt von Erfolg gekrönt ist, hängt vom Anbieter ab. Der Benutzer ist somit gewissermaßen dem Wohlwollen der Anbieter ausgeliefert und das Verfahren kann ein durchaus langwieriges Prozedere sein. Google bietet dazu beispielsweise ein Formular an: Löschantrag. Die Einschränkung ist dabei jedoch, dass nicht die Information selbst, sondern nur der darauf verweisende Suchmaschineneintrag entfernt wird, und somit eine Auseinandersetzung mit weiteren Anbietern notwendig ist. Ist die Information dann auch noch auf diversen Plattformen gespiegelt bzw. redundant gespeichert, ist vollständige Löschung oft unmöglich.
Der populär gewordene Fall des „Techno Viking“ zeigt, wie problematisch allein schon die Durchsetzung von Persönlichkeitsrechen z.B. bei Videoinhalten in der Praxis aussehen kann. Es ist auch menschlich, und somit in Anbetracht eines niemals vergessenden Internets problematisch, wenn man sich evtl. gar nicht mehr erinnert, was man von 10, 20 Jahren irgendwo gepostet hat. Wenn in der Jugend gepostete Inhalte dann im späteren Erwachsenenalter als digitaler Bumerang zurückkehren, ist es zu spät für den Löschantrag – ein Automatismus in Form eines Ablaufdatums, für beispielsweise Postings in sozialen Medien, wäre hierbei viel wirksamer.
Natürlich kommt in der Diskussion immer wieder das Killer-Argument, man solle sich doch einfach immer korrekt (wer bestimmt, was gerade korrekt ist? Der empörte Mob, die Politik?) verhalten bzw. äußern, dann habe man doch nichts zu befürchten. Wer nichts anstellt, hat auch nichts zu verbergen. Auf den Unsinn solch einer Argumentation soll hier nicht weiter eingegangen werden, zumal allein schon der Ansatz der Selbstzensur, der solch Forderungen innewohnt, von mündigen Individuen im Sinne einer freien und diversen Gesellschaft nur abgelehnt werden kann.
Wir sehen beispielsweise anhand der Political-Correctness-Diskussionen, wie sich innerhalb weniger Jahre, manche im damaligen zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext akzeptierte Ansichten und übliche Redensarten in später geächtete Hate-Speech transformieren können – Instrumentalisiert sowohl vorrangig von der politischen Linken als auch der Rechten. Eine Cancel-Culture etabliert sich, die Menschen aufgrund einzelner, oft natürlich auch begründet kritisierter Aussagen, beruflich und privat diskreditiert und mundtot macht. Anstelle der Diskussion und Aufarbeitung tritt die systematische Zerstörung der Credibility, die öffentlich in sozialen Medien zelebrierte Beschädigung der Glaubwürdigkeit und Integrität einer Person. Keine zweite Chance – Das Internet vergisst nichts. Ein Kommentar mit Augenzwinkern vor 10 Jahren kann heute den Job kosten. Man unterstellt dem Menschen kein Potenzial zur Änderung oder persönlichen Weiterentwicklung und wertet unbedachte Äußerungen als charakterliche Klassifizierung einer Person, reduziert den Wert eines Menschen auf einzelne Aussagen. Eine einzige Aussage, oft aus dem Kontext gerissen reicht, um jemand als Gutmensch/Weißer alter Mann/Feminazi/Willkommensschreier/Rassist/Sexist/Covidiot/Hater/Öko-Terrorist/religiöser Fanatiker oder was auch immer zu titulieren bzw. selbstgerecht zu brandmarken.
Personalabteilungen recherchieren beispielsweise die Äußerungen in sozialen Medien, um Bewerber zu selektieren. Dieses reduzierte und verkürzte digitale Abbild einer Person dient primär nicht dazu, die besten Mitarbeiter zu rekrutieren, sondern der Wahrung des öffentlichen Images des Unternehmens. Man möchte natürlich keinen shitstorm riskieren, weil ein Mitarbeiter evtl. früher mal einen blöden Kommentar irgendwo reingesetzt hat und heute die Twitteria selbstgerecht den vermeintlichen Täter an den digitalen Pranger stellen könnte. Interessant wird die Sache bei politischen Äußerungen: Wenn sich ein System oder Regime ändert, kann die früher geäußerte Meinung schnell zum Verhängnis werden. Aktuell sehen wir in Sachen Corona-Virus eine Spaltung der Gesellschaft, wo auf beiden Seiten fragwürdiger Content produziert wird, der später manch einem sicherlich den Job oder eine Anstellung kostet, je nachdem wie sich der Mainstream entwickelt. In ein paar Jahren heißt es dann z.B. aufgrund eines Facebook-Postings, welches man in einem emotionalen Moment absetzte: Du warst ein Covidiot/Corona-Sektenanhänger/Maßnahmenbefürworter, du bist zwar qualifiziert, aber wir gehen kein Risiko ein. Danke für ihre Bewerbung.
Ansichten, gesellschaftliche und politische Normen, der Mainstream ändern sich – das was irgendwann mal gepostet wurde jedoch nicht, der Mensch hinter dem Posting vielleicht schon.
Wie könnte eine Umsetzung des Rechts auf Vergessenwerden nun aussehen?
Meine Ideen und Ansätze wären dabei ein Kompromiss aus der Abwägung verschiedener Interessen und kombinieren die automatische Löschung mit dem gegenwärtigen Recht auf Richtigstellung und Löschanträgen:
- Die besten Daten sind jene, die erst gar nicht generiert werden. Was nirgends abrufbar ist, kann nicht gegen einen verwendet werden. Das ist natürlich die Grundregel im Datenschutz, soll aber nicht zur Selbstzensur oder einer Situation wie unter Metternich führen. Deshalb sind Automatismen zur Inhaltslöschung, sowie Rechte zur Richtigstellung und Löschanträge in Kombination notwendig.
- Inhalte in sozialen Medien müssen bei der Erstellung durch den Benutzer zwingend mit einem Ablaufdatum versehen werden. Dieses kann auf Wunsch des Users natürlich auch 100 Jahre in der Zukunft liegen. Der Plattformbetreiber muss die Löschung dann zwingend zum gegebenen Datum vornehmen.
- Attribute in HTML, z.B. bei semantischen Tags wie <article>, die ein Ablaufdatum definieren, welches betroffene Sektionen serverseitig vor der Auslieferung des Dokuments entfernt: <article expiration=“2023″> könnte beispielsweise bedeuten, dass der Webserver diesen Bereich im HTML-Dokument ab dem 1.1.2023 dem client/Browser nicht mehr übermittelt.
- Personen des öffentlichen Lebens (Politiker, Streamer…) könnten aufgrund ihrer Vorbildrolle und dem damit zu erwartendem Verantwortungsbewusstsein von Löschanträgen in bestimmten Fällen ausgenommen sein. Ob zwischen privatem und öffentlichem Diskurs unterschieden werden sollte, vermag ich gegenwärtig nicht einzuschätzen.
- Ich sehe das Recht auf Vergessenwerden primär für Inhalte von Privatpersonen in sozialen Medien und Plattformen, die sich der direkten Kontrolle des Benutzers entziehen. Der Benutzer muss im Vorhinein definieren können, wie lange Inhalte zugänglich sind.
- Ausnahmen von Löschanträgen könnten für die Presse gelten, da diese dem Journalistischen Kodex unterworfen sind und ein Recht auf Richtigstellung als ausreichend betrachtet werden kann. Berichterstattung muss unter anderen Gesichtspunkten betrachtet werden, als persönliche Äußerungen.
- Ausnahmen können auch für durch peer-review verwaltete Verzeichnisse gelten, z.B. Wikipedia. Außer es handelt sich um nachgewiesene Falschinformation, wo dann das Recht auf Richtigstellung greifen kann.
- Bei Foto- und Videoaufnahmen scheint die gegenwärtige Rechtslage ausreichend. KI-Systeme könnten in Zukunft bei der Erkennung von Inhalten, welche Persönlichkeitsrechte verletzen, hilfreich sein.
- Internationale Abkommen: Ein Alleingang Europas ist nicht zielführend, zumal so gut wie alle relevanten Plattformen in den USA, China oder im europäischen Ausland liegen.
- Eventuell könnte auch angedacht werden, persönliche Profile nach Ablauf von 100 Jahren automatisch zu löschen bzw. auf ein Informationsminimum (Name, Alter, Profilbild, …) zu reduzieren.
Im Zeitalter der Datenverknüpfung, des maschinellen Lernens, mächtiger Suchmaschinen und hocheffizienter Algorithmen müssen persönliche Informationen und Äußerungen mit größter Sorgfalt verarbeitet werden. Das Abbild einer Person in der digitalen Infosphäre kann die Gesamtheit des Wesens einer reellen Person nicht repräsentieren bzw. ist dieses im positiven oder negativen Sinne manipulierbar und Fehlinterpretationen unterworfen. Daraus entsteht der Ansatz des Rechts auf Vergessenwerden.
Tipp: Browser-Plugin um Cookie-Dialoge auszublenden.